
Eine Stadt, in der (fast) alles selber hergestellt werden kann?
Das dtec.bw Forschungsprojekt Fab City Hamburg untersucht, wie Städte durch den Einsatz offener Produktionsinfrastrukturen und digitaler Fertigungstechnologien unabhängiger von globalen Lieferketten werden und gleichzeitig lokale, kreislauffähige Wertschöpfung fördern können. Ziel ist es, eine resiliente urbane Produktion zu etablieren, die Bürger:innen, Maker:innen, Wissenschaft und Kommunen vernetzt – von der Idee bis zum Produkt.
Im Fokus steht dabei die systemische Verknüpfung von technologischer Entwicklung mit Governance-Strukturen, Bildungsformaten und gesellschaftlicher Teilhabe.
Im Rahmen des Projekts wurden dafür bereits neun thematisch spezialisierte Reallabore in der Metropolregion Hamburg etabliert, sogenannte OpenLabs. OpenLabs sind offene stationäre oder mobile Werkstätten im öffentlichen Raum, die dazu dienen kollaborative, verteilte Produktentwicklung und Fertigung in unterschiedlichen Stakeholder Konstellationen zu erproben. Als konkrete Lern- und Innovationsräume in der Stadt bieten sie einen niedrigschwelligen Zugang zu digitalen Fertigungstechnologien.
Intro
Was bietet das Playbook?
Vielschichtige Einblicke von Hamburgs Reise zu einer selbstversorgenden „Fabrication City“: Ein Playbook für eine zirkulär und digital gestärkte Stadt. Was passiert, wenn Bürger:innen zu Macher:innen werden und Städte wieder anfangen zu produzieren? Auf mehr als 100 farbenfrohen Seiten zeigt das Playbook wie das Living Lab der Fab City Hamburg lokale Produktion und globale Wirkung erforscht und verbindet.
Aus einem breiten Spektrum an realen Projekten für die eigene Stadt, Labs oder Initiativen lernen.
Labs, Orte und Menschen hinter der Bewegung entdecken.
- Inspiration für Circular Economy in der Nachbarschaft.
Interdisziplinär vereint für die Stadt von morgen
Ein inter- und transdisziplinäres Konsortium aus über 30 Partnerinstitutionen untersucht die theoretischen und praktischen Grundlagen urbaner Produktionssysteme. Dabei kommen Perspektiven aus Ingenieur-, Wirtschafts-, Sozial-, Rechts- und Bildungswissenschaften ebenso zur Anwendung wie Ansätze aus Stadtplanung, Logistik und Digitalisierung.
Die entwickelten Technologien und Formate werden offen dokumentiert und modular konzipiert, um Skalierbarkeit, globale Reproduzierbarkeit und partizipative Weiterentwicklung zu ermöglichen. Das Projekt zielt auf eine fundierte wissenschaftliche Grundlage zur Implementierung zukunftsfähiger, lokalisierter Produktionsökosysteme im urbanen Raum.
Schwerpunkte
Open Labs
Entwicklung und Erprobung von OpenLabs als niedrigschwellige Zugänge zu digitalen Fertigungstechnologien und lokaler Produktion im urbanen Raum mit unterschiedlichen sektorspezifischen Schwerpunktsetzungen zur Innovationsförderung und technologischen Weiterbildung.
- OpenLab Hamburg an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
- OpenLab MedTec am Bundeswehrkrankenhaus Hamburg: Entwicklung von offenen Medizintechnik-Lösungen – etwa für Pflege, Rehabilitation oder Notfallhilfe.
- OpenLab Mobile in Kooperation mit der Süderelbe AG Ein mobiles Fab Lab in einem umgebauten Truck – flexibel einsetzbar in Stadtteilen, auf Veranstaltungen oder an Bildungseinrichtungen.
- OpenLab Microfactory – vom Fabrikationslabor zur mobilen Mikrofabrik, zuletzt aufgestellt im Pop-Up Circular Hub im Jupiter, dem deutschen Vorzeigeprojekt für die kreative Reaktivierung von Leerstand und die Transformation innerstädtischer Räume. Aktuell ausgestellt im FABRIC – Große Bleichen 21, Galleria Passage
- OpenLab Circular Plastics beim Insel e.V.: Arbeiten mit recycelten Kunststoffen, etwa durch Spritzguss, Extrusion oder Pressverfahren.
- OpenLab Food mit der Klimaschutzstiftung Hamburg: Pilotprojekte im Bereich Open Source Landwirtschaft mit Fokus auf lokale und nachhaltige Lebensmittelproduktion, z. B. Farm Roboter, Urban Gardening, Hydroponik oder Fermentation.
- OpenLab Circular Textiles von House of All: Experimentierraum für zirkuläre Textilproduktion – inklusive Reparatur, Upcycling und offenen Designprozessen.
- Open Lab Port mit der Hamburg Port Authority: Nutzung bestehender Räume am homePort im Hamburger Hafen zur Verbindung von maritimer Wirtschaft, Nachhaltigkeit und lokaler Produktion.
- Gestaltung und Umsetzung innovativer Bildungsformate zur Vermittlung von Fertigungskompetenz, Reparaturwissen und nachhaltigen Design- und Produktionspraktiken
Open Source Technologieentwicklung
- ein modulares, quelloffenes Toolkit mit digitalen Fertigungswerkzeugen, das unter anderem kleine und großformatige CNC-Fräsen, 3D-Drucker und Scanner sowie Laserschneider umfasst. Das Set kann z.B. für Fab Labs, OpenLabs, oder mobile Mikrofabriken zum Aufbau und der Konfigurierung von kleinskalierten Fertigungsumgebungen genutzt werden, mit dem Ziel der Schaffung einer modularen, physischen Produktionsinfrastruktur für die Stadt der Zukunft
- Optimierung und Weiterentwicklung der technischen Dokumentation und Qualitätssicherung von komplexen Open Source Hardware Maschinen in Kooperation mit der TU Berlin
- Erforschung rechtlicher Fragen zu Open Source Hardware in Kooperation mit dem IP Center der Bucerius Law School
Transition Governance, Citizen Innovation und Wirkungsanalyse
- Erforschung von Transition Governance-Modellen auf städtischer Ebene in Kooperation mit der HafenCity Universität Hamburg (hcu)
- Handlungsempfehlungen für die stadtbauliche Integration und Quartiersentwicklung in Kooperation mit der hcu
- Erforschung der Beteiligung von Bürger:innen an ko-kreativen Innovationsprozessen und partizipativer Technologieentwicklung in Kooperation mit der Kühne Logistics University
- Integration lokaler und globaler Communities of Practice
- Entwicklung von Metriken zur Wirkungsanalyse sowie eines umfassenden Fab City Produktportfolios in Kooperation mit dem MIT – The Center for Bits and Atoms und dem Fab City Hamburg e.V.
Fab City Vision
Motivation
Globale Lieferketten sind fragil, Ressourcen endlich und industrielle Wertschöpfung oft weder nachhaltig noch gerecht. Gleichzeitig entstehen in Städten weltweit neue Formen lokaler Produktion – digital vernetzt, gemeinschaftlich organisiert, ressourcenschonend.
Unsere Mission: Von PITO (Product In Trash Out) → DIDO (Data In Data Out), was den Übergang von Abfall-orientierter Konsumgesellschaft zur daten- und wissensbasierten, lokalen Produktionsökonomie beschreibt. Mehr dazu im Fab-Dictionary.


Lokale Produktion
Das dtec.bw Projekt Fab City Hamburg greift die Entwicklung von PITO zu DIDO auf und erforscht, wie eine resiliente, digitale und zirkuläre Produktionsinfrastruktur im urbanen Raum aussehen kann. Es schafft praktische, skalierbare Ansätze für urbane Fertigung und unterstützt Hamburg dabei, Teil einer globalen Bewegung für nachhaltige Stadtentwicklung zu sein. Mehr zur Urbanen Produktion hier.
Zentrale Ergebnisse
- Aufbau und Durchführung von 9 OpenLab-Pilotprojekten in Hamburg und 15 weiteren Pop-up Laboren zur Erforschung und Umsetzung lokaler Produktionskonzepte in verschiedenen Kontexten
- Durchführung von über 154 Workshops, Interviews und partizipativen Formaten mit über 2.000 Teilnehmenden aus Verwaltung, Zivilgesellschaft, Kreativwirtschaft und Handwerk.
- Entwicklung von 17 Open Source Hardware Prototypen, wie das OpenLab Starter Kit, der OSAMbot (Open-source Agricultural Mobile Robot) oder das LibreSolar Kit für erneuerbare Energien
- Begleitforschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (10 laufende und z.T. abgeschlossene Promotionen)
- Entwicklung des OpenLab Data Monitoring Systems zur automatisierten Erfassung und Visualisierung von Produktionsdaten im Kontext der Überwachung und Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien (z.B. Material- und Energieverbrauch)
- Open-Access-Buchveröffentlichung bei Springer Nature mit dem Titel: Global collaboration, local production: Fab City als Modell für Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Entwicklung | SpringerLink
- Veröffentlichung des Fab City Playbooks als praxisnahes Handbuch für Kommunen, Maker-Communities und andere Akteur:innen zur Umsetzung von Fab City-Prinzipien.
- Verstetigung und Weiterentwicklung von Projektergebnissen im Rahmen von Folgeprojekten wie INTERFACER (EU), LAUDS (EU), DATipilot (BMFTR)
OpenLab Einblicke
Die vier kurzen Videoclips geben Einblicke in die Präsentation und einen Einsatzort des OpenLab Starter Kits, die Möglichkeiten und Forschungsarbeit in der OpenLab Microfactory sowie des OpenLab MedTec am Bundeswehrkrankenhaus Hamburg.
Konsortialpartner

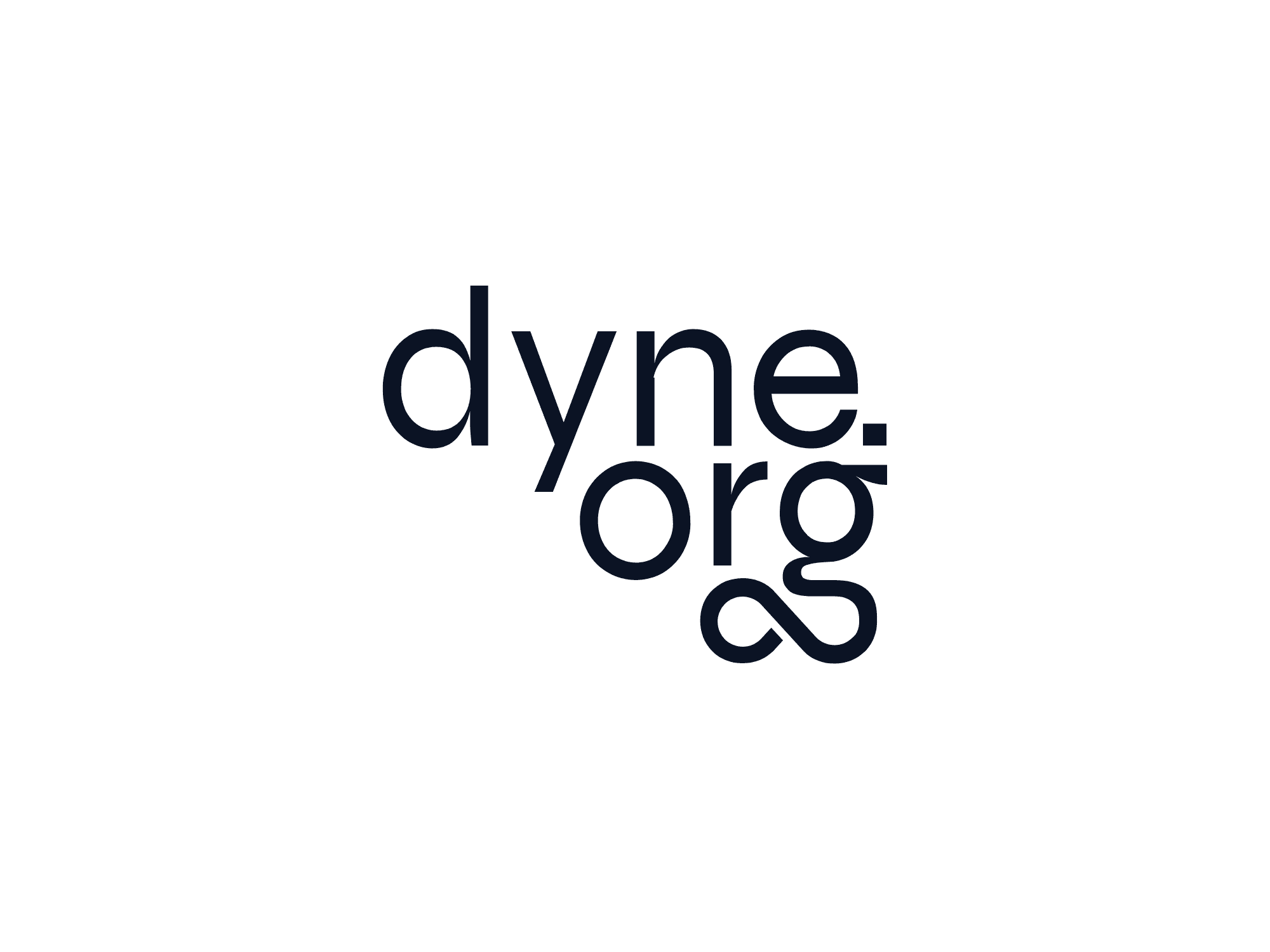
Impressionen

Konsortialtreffen, Präsentation: Florian Cramer, Kühne Logistics Universität, Urban Food Production

Workshop „Libre Solar Box“

OpenLab Mobile: Ein umgebauter Truck als mobile Produktionswerkstatt für Hamburg und die Metropolregion

OpenLab Mobile: Ein umgebauter Truck als mobile Produktionswerkstatt für Hamburg und die Metropolregion

Konsortialtreffen, Diskussion: „Measuring the Impact: Fab City Fullstack Metrics“

Konsortialtreffen: Präsentation

Konsortialtreffen Austausch

OpenLab MedTec am Bundeswehrkrankenhaus Hamburg: Ein Knotenpunkt für kooperative, quelloffene Medizintechnik.

Konsortialtreffen, Präsentation: Merle Ibach, Hafencity Universität Hamburg, Transition Governance

OpenLab Starter Kit Entwicklung: Ein Set von quelloffenen Maschinen für Fab Labs and Open Labs

Das „“Pop-Up Circular Hub:“ Ausstellung, Veranstaltungen, Workshops und Bildungsangebote rund um das Thema „Circular Economy“ mitten in der Hamburger Innenstadt
Fabrication City
Die Fab City Bewegung
Nachdem die Freie und Hansestadt Hamburg sich im Juni 2019 als erste deutsche Stadt der globalen Initiative der Fab Cities angeschlossen, wurde im Oktober 2020 mit Hamburger Fab Labs, Makerspaces, Werkstätten, innovativen Start-ups und Forschungseinrichtungen der Verein Fab City Hamburg e.V. gegründet.
Urbane Produktion
OpenLab Ökosystem
Das Open Lab Ökosystem vernetzt dezentrale, offene Produktionswerkstätten (OpenLabs) in der Metropolregion Hamburg und macht digitale Fertigung niedrigschwellig zugänglich – im Rahmen des Fab-City-Forschungsprojekts. Durch Open-Source-Hardware fördert es lokale Innovationsprojekte und urbane Produktion und dient zugleich als „Living Lab“ für nachhaltige Stadtentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe.
Fab-Dictionary
Fab City Global Initiative
Die Fab City Global Initiative hat das Ziel, Städte bis 2054 in resiliente, regenerative Kreislaufsysteme zu verwandeln: Alles, was konsumiert wird, soll möglichst lokal produziert werden. Statt Containerschiffen voller Produkte zirkulieren nur noch Daten global, also offene Baupläne, Design-Dateien und Produktionswissen. Lokale Maker-Communities, Werkstätten, Mikro-Fabriken und digitale Plattformen ermöglichen diese neue Form urbaner Wertschöpfung. Hamburg ist Teil der globalen Fab City Community – einem Netzwerk von mehr als 40 Städten und über 11 Regionen weltweit, die an dieser Transformation arbeiten. Gemeinsam zeigen sie, wie nachhaltige Produktion, digitale Teilhabe und soziale Innovation im urbanen Raum zusammenwirken können.
From PITO to DIDO
Das DIDO‑Modell steht im Zentrum der Fab City Vision und beschreibt einen grundlegenden Wandel in der urbanen Wertschöpfung:
PITO (Products In – Trash Out) beschreibt das klassische industrielle Produktionsmodell globalisierter Städte: Physische Produkte (Waren) werden in global verteilten Wertketten massengefertigt und von Städten importiert (Products In), die nach Nutzung zu Abfall werden und anschließend exportiert (Trash Out).
DIDO (Data In – Data Out) dagegen stellt auf ein datenbasiertes Paradigma um – es entsteht echter Mehrwert durch Offenheit und Modularität: Digitale Entwürfe, Designs, Anleitungen und Fertigungswissen werden global geteilt (Data In – Data Out), während Produkte lokal aus Materialien vor Ort hergestellt und nach Gebrauch wieder im eigenen System recycelt und verarbeitet werden.
Das DIDO Modell fördert:
- Kreislaufwirtschaft – physische Ressourcen bleiben regional im Umlauf.
- Globale Vernetzung – digitale Designs und Know‑how verbreiten sich weltweit.
- Nachhaltigkeit und Resilienz – lokale Produktion reduziert Lieferkettenrisiken und Umweltbelastung.
Fazit: PITO→DIDO bedeutet den Übergang von Abfall-orientierter Konsumgesellschaft zur daten- und wissenbasierten, lokalen Produktionsökonomie – Schlüssel für selbstversorgende und nachhaltige Städte.
(Quellen: Fab-City Whitepaper, Fab City Global Initiative: Join Sustainable Cities Movement, The Fab City Full Stack | SpringerLink)

Urbane Produktion
Produktion war früher ein fester Bestandteil städtischen Lebens – sichtbar etwa an Straßennamen wie Schmiedegasse oder der berühmten Reeperbahn in Hamburg, benannt nach den Reepschlägern, die Schiffstaue für den nahe gelegenen Hafen herstellten. Mit der zunehmenden Industrialisierung verlagerte sich die Produktion jedoch zunehmend an die Stadtränder. Gründe waren hoher Flächenbedarf, Immissionsschutz, steigende Bodenpreise und hygienische Anforderungen.
Nach jahrzehntelanger Funktionstrennung (Wohnen versus Arbeiten) wird unter dem Begriff Urbane Produktion seit einigen Jahren die Rückkehr der Produktion in das städtische Gefüge diskutiert. Urbane Produktion bezeichnet hier die Herstellung materieller Güter in Städten mit überwiegend lokal verfügbaren Ressourcen und kurzen Lieferketten – etwa in kleinen Manufakturen oder Mikrofabriken. Sie bringt Produktion näher an den Konsum, schafft Jobs und stärkt die städtische Gemeinschaft und das Bewusstsein für Herstellungsprozesse.
Doch ökologische und soziale Probleme globaler Vorproduktionen bleiben oft unsichtbar oder werden bewusst ignoriert. Für eine nachhaltige Bewertung braucht es systemische Ansätze wie Lebenszyklus- und Stoffstromanalysen, die globale Auswirkungen einbeziehen.
Kurz gesagt:
Urbane Produktion in der Fab City bedeutet, dass Städte wieder selbst herstellen, was sie brauchen – mit Hilfe digitaler Technologien, lokaler Werkstätten und offenem Wissen. Das stärkt die Gemeinschaft, schützt die Umwelt und macht Städte zukunftsfähig. Es bedarf aber noch weiterer Forschung und Erprobung für eine nachhaltige Bewertung neuer Formen urbaner Produktion.
Quelle: Die Produktive Stadt: (Re-) Integration der Urbanen Produktion | SpringerLink
Open Lab
Ein OpenLab ist eine offene Werkstatt im Quartier – ausgestattet mit Werkzeugmaschinen, Materialien und Know-how. In diesen Werkstätten können Bürger:innen, Schüler:innen, Start-ups oder Handwerker:innen gemeinsam lernen, entwickeln und Dinge herstellen.
Die Baupläne (z. B. für Möbel oder Maschinen) werden digital geteilt – jeder kann sie weiterentwickeln und lokal umsetzen nach dem Motto: selbst gestalten, reparieren, lernen oder eigene Ideen umsetzen. OpenLabs fördern kreative Selbstermächtigung, bieten niederschwellige Zugänge zu Technologie und stärken die lokale Gemeinschaft. Sie sind Schnittstellen von Bildung, Technik und Beteiligung.
Mikrofabriken
Mikrofabriken sind kleine bis mittelgroße, modulare Produktionsstätten, die moderne Technologien einsetzen, um ihre Abläufe zu optimieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Fabriken können sie erhebliche Kosten-, Effizienz- und Energieeinsparungen erzielen.
Die OpenLab Microfactory ist eine kleine, modulare Produktionsstätte mitten in der Stadt, die als „Pop-up“-Reallabor fungiert. Ziel ist es, dezentrale, digitale und partizipative Produktion von Klein- bis Mittelserien direkt in der urbanen Umgebung zu erproben.
Kernpunkte auf einen Blick:
Kompakt & skalierbar: Die Microfactory besteht aus Open-Source Werkzeugmaschinen (z. B. OpenLab Starter Kit), Software und Sensoren zur Erfassung von Energie- und Materialdaten
Datenbasiert & transparent: Verbrauchs- und Betriebsdaten werden offen dargestellt – zur Analyse von Ressourcenverbrauch und ökologischer Wirkung
Pop-up Implementierung: Die Module werden temporär an Orten wie zuletzt dem Pop-Up Circular Hub (Jupiter) oder Fachmessen aufgebaut – so sichtbar und zugänglich für die Öffentlichkeit. Aktuell im FABRIC ausgestellt!
Bildung & Partizipation: Es gibt Workshops, Führungen und Ausstellungen, um Bürger:innen aktiv in Produktion und Circular-Economy-Konzepte einzubeziehen
Warum das wichtig ist:
- Fördert lokale Fertigung und reduziert Abhängigkeiten von globalen Lieferketten.
- Unterstützt Kreislaufwirtschaft durch transparente Daten und Modularität.
- Ermöglicht technologische Teilhabe – Stadtbewohner:innen erleben, gestalten und verstehen Produktionsprozesse.
Kurz gesagt: Die Microfactory ist ein urbanes Werkzeug, um gemeinsam nachhaltig, innovativ und kooperativ in der Stadt herzustellen. Mehr unter: openlab.hamburg
Projekttitel und Laufzeit
Fab City – Dezentrale, digitale Produktion für die urbane Wertschöpfung, 2021 – 2026






