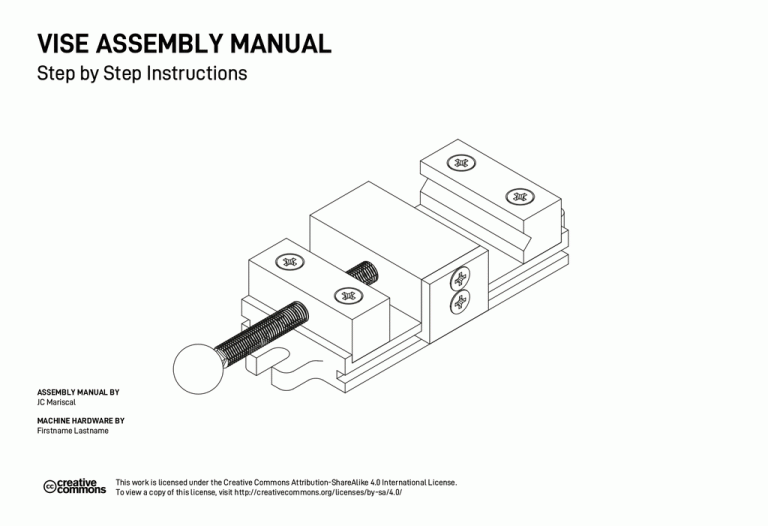Digitale Souveränität durch Open Source und Makerspaces
Wie digitale Kompetenzen, Open Source Hardware und Makerspaces Innovationspotenziale im Globalen Süden stärken – Einblicke aus dem Panel mit Anna Sophie Herken, Debora Maboya, Manuel Moritz und Katie Gallus
Die re:publica 2025 stand unter dem Leitmotiv digitaler Transformation, Teilhabe und globaler Gerechtigkeit. Eines der inhaltlich dichtesten Panels war die Diskussion „Makers, Movers and Digital Innovators – How Digital Skills Empower Africa to Drive Global Transformation“, bei der unter anderem Anna Sophie Herken (GIZ), Debora Maboya (Makerin & Aktivistin), Manuel Moritz (Expert Digital Skills, GIZ, New Production Institute) sowie Moderatorin Katie Gallus Einblicke aus der Praxis, Entwicklungszusammenarbeit und Forschung gaben.
Organisiert wurde die Veranstaltung von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) mit Unterstützung von Ronja Hölzer und ihrem Team.
Panel Discussion mit
Manuel Moritz
Wie digitale Fähigkeiten Afrika befähigen, die globale Transformation voranzutreiben.
Digitale Kompetenzen als Schlüsselinfrastruktur für gesellschaftlichen Wandel
Im Zentrum des Panels stand die Frage, wie digitale Kompetenzen nicht nur zur beruflichen Qualifikation, sondern auch zur strukturellen Ermächtigung beitragen können. Manuel Moritz, der bei der GIZ an der Schnittstelle zwischen Bildung und Innovation arbeitet, betonte:
„Digital literacy ist nicht nur ein Bildungsziel – sie ist ein Instrument für strukturelle Selbstbestimmung, wirtschaftliche Teilhabe und demokratische Mitgestaltung.“
Diese Perspektive deckt sich mit aktuellen Forschungsergebnissen, die zeigen, dass digitale Kompetenzen insbesondere in afrikanischen Ländern maßgeblich zur Innovationsdynamik beitragen – sofern der Zugang systematisch gefördert wird.
Makerspaces als Räume für Innovation und Selbstwirksamkeit
Debora Maboya illustrierte anhand konkreter Erfahrungen aus lokalen Makerspaces, wie technologische Bildung ganz praktisch erfahrbar wird – durch Reparaturprojekte, Eigenbau von Sensorik oder die Entwicklung nachhaltiger Hardwarelösungen für den lokalen Kontext.
Makerspaces ermöglichen:
- Lernen durch Praxis: Jugendliche bauen, testen und verbessern reale Produkte
- Community Building: Wissen wird geteilt, generationenübergreifend weitergegeben
- Technologische Selbstermächtigung: statt Konsumentinnen, aktive Entwicklerinnen
Diese offenen Räume stehen exemplarisch für einen bildungspolitischen Paradigmenwechsel: Weg von frontaler Wissensvermittlung – hin zu experimenteller, selbstorganisierter und interdisziplinärer Kompetenzentwicklung.
Open Source Hardware: Demokratisierung durch Offenheit
In der Diskussion wurde zudem die strategische Bedeutung von Open Source Hardware hervorgehoben. Im Gegensatz zu proprietären Systemen erlauben offene Designs eine breite Adaption und Weiterentwicklung, insbesondere in ressourcenlimitierten Regionen.
Anna Sophie Herken wies darauf hin, dass solche Technologien integraler Bestandteil der Entwicklungszusammenarbeit werden müssen – nicht als Zusatz, sondern als Basis-Infrastruktur, die lokale Innovationsökosysteme stärkt.
Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion
Ein wiederkehrendes Thema war die gezielte Förderung von Mädchen und Frauen in technischen Bildungsfeldern. Debora Maboya sprach offen über geschlechterspezifische Barrieren – von fehlender Repräsentation bis hin zu kulturell geprägten Rollenerwartungen – und betonte:
„Technologie braucht Diversität. Nur dann entstehen Lösungen, die für alle funktionieren.“
Programme, die auf weibliche Teilhabe ausgerichtet sind, zeigen laut GIZ positive Effekte auf das gesamte Innovationsumfeld – eine Erkenntnis, die stärker in institutionelle Förderlogiken integriert werden sollte.
Internationale Zusammenarbeit: Partnerschaften auf Augenhöhe
Manuel Moritz unterstrich, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht länger auf reinen Technologietransfer setzen dürfe, sondern auf Ko-Kreation, Wissenstransfer und strukturellen Dialog. Erfolgreiche Beispiele seien u.a. gemeinsame Maker-Ausbildungsprogramme, digitale Bildungsplattformen oder die Förderung regionaler FabLabs in Subsahara-Afrika.
Die GIZ sieht sich dabei nicht nur als Förderinstitution, sondern als Vermittler und Plattform für kollaborative Innovation.
Handlungsempfehlungen für Forschung, Politik und Entwicklungsakteure
Zielsetzung | Konkrete Maßnahmen |
|---|---|
Digitale Grundbildungsystematisch fördern | Makerspaces an Schulen, Berufsschulen und Universitäten integrieren |
Inklusive Innovationsstrukturen schaffen | Genderfokussierte Förderprogramme, Peer-Mentoring und Role Models |
Open Source Kultur etablieren | Förderlinien für Open Hardware-Initiativen und Community-Labs |
Internationale Kooperationsformate stärken | Süd-Nord-Partnerschaften zwischen Hochschulen, Tech-Zentren & NGOs |
Ausblick
Das Panel zeigte eindrucksvoll, wie technologische Bildung, offene Infrastrukturen und internationale Zusammenarbeit zusammenspielen, um globale Resilienz zu fördern. Makerspaces und Open Source Hardware sind dabei keine Nischenerscheinungen mehr – sondern strategische Elemente einer inklusiven, nachhaltigen und souveränen Digitalpolitik.
Forschungsinstitute stehen in der Verantwortung, diese Entwicklungen analytisch zu begleiten, in Wirkungsmessung zu überführen – und selbst aktiv mitzugestalten.